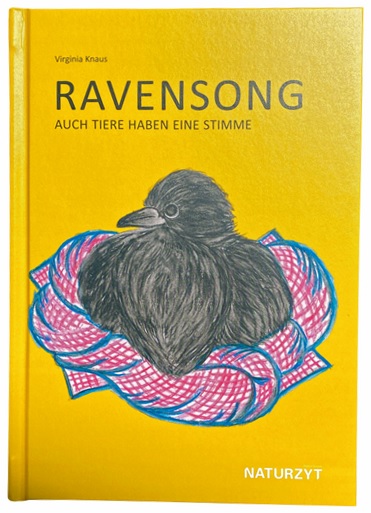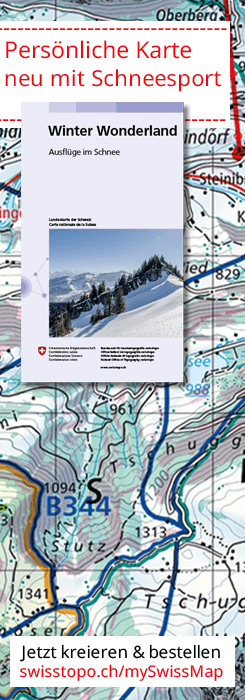Der Giersch ist neben der Brennnessel eines unserer ältesten Wildgemüse. In der Volksmedizin gilt der Giersch als vorzügliches Mittel gegen Rheuma und Gicht.
Giersch oder Geissfuss in der Natur
Den Giersch oder Geissfuss finden wir an Waldrändern, Uferbereichen, entlang von Waldwegen, unter Hecken und Gebüschen und in Gärten und Parks. Er liebt nährstoffreiche und feuchte Böden. Mit dem Beginn des Frühjahrs treibt der Giersch aus seinem weitverzweigten Wurzelgeflecht zartgrüne, dreigeteilte Blätter aus. Das brachte ihm den Volksnamen «Dreiblatt» ein. Die Blätter laufen spitz zu und sind am Rand unregelmässig gezähnt. Seitliche Blattteile sind meist noch nicht vollständig voneinander getrennt, was eine Blattform erkennen lässt, die einem Ziegenhuf ähnlich ist – daher der Name «Geissfuss». Im ganz jungen Zustand sind die Blätter glänzend hellgrün, sehen etwas gefaltet aus und verströmen beim Zerreiben einen leicht Duft, der etwas an Petersilie erinnert.
Die dreikantigen und V-förmigen Blattstiele sind ein gutes Erkennungsmerkmal für Sammler. An der Spitze der kräftigen, hohlen und längsgerillten Stängel bilden kleine weisse Blütenköpfchen zarte halbkugelförmige Dolden. Aus den Blüten entwickeln sich im Herbst kleine eiförmige, braune Früchte. Wie die Karotte oder Petersilie zählt der Giersch zur Familie der Doldenblütler.
Der botanische Name des Gierschs, Aegopodium podagraria, stammt vom griechischen «aigos», was Ziege bedeutet, und «podos», was Fuss heisst, und verweist auf die Blattform, in der die Menschen früher einen Ziegenfuss sahen. Der Zusatz «podagraria» ist ein Hinweis auf die Heilwirkung bei Gicht – «podagra» wurde damals die Fussgicht genannt. Der Volksname «Zipperleinkraut» deutet ebenso auf die Verwendung bei rheumatischen Erkrankungen und Gicht hin. Achtung Verwechslungsgefahr: Der Giersch kann mit anderen Doldenblütengewächsen verwechselt werden. Darunter finden sich auch stark giftige Pf anzen wie die Hundspetersilie, der Wasserschierling und der Gefleckte Schierling. Die weissblühenden Doldenblütler sollte man daher genau kennen.

Aus einem Wurzelbruchstück wächst eine neue Pflanze
Mit seinen unterirdischen Ausläufern und seiner unbändigen Lebenskraft erobert der Giersch den Garten, was schon so manchen Gärtner zur Verzweiflung gebracht hat. Ausrupfen und jäten bringt nichts. Aus jedem kleinsten Wurzelbruchstück wächst ein neues Pflänzchen. Wenn also der Giersch am falschen Platz wächst, dann hilft am besten ernten und essen! Der Geissfuss ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen. «Unkraut nennt man die Pflanzen, deren Vorzüge noch nicht erkannt worden sind.» (Ralph Waldo Emerson)
Giersch ernten und aufbewahren
Blätter langsam im Schatten trocknen und in Papier- oder Stoffbeuteln aufbewahren.
Was sagen die alten Kräuterkundigen zur Giersch?
Tabernaemontanus (16. Jh.) bezeichnete den Giersch in seinem Kräuterbuch «als gute Arzney wider das Zipperlein, Gliedtsucht und die Schmertzen der Hüfft ». Mit Zipperlein sind Gichtbeschwerden gemeint. Im Mittelalter wurde Giersch in den Klostergärten kultiviert. Kräuterpfarrer Künzle nannte den Giersch als heilsame Medizin gegen alle Arten von Rheuma, Ischias, Gicht und Podagra.
Giersch ist rein an Vitamin C und Minteralstoffen
Giersch beinhaltet ein Mehrfaches an Vitamin A, Vitamin C und Eiweiss als der Kopfsalat. Er ist reich an Mineralstoffen und Spurenelementen wie Eisen, Kalium, Kupfer, Zink, Mangan. Ausserdem enthält der Giersch ätherisches Öl, Bitterstoffe, Flavonoide und Carotinoide.
Giersch hilft bei Gicht und Rheuma
Giersch ist eine alte Heilpflanze, die schon seit Urzeiten von der Menschheit genutzt wird. Schon früh wurden die stärkenden, harntreibenden und entsäuernden Eigenschaft en erkannt. In der Volksheilkunde wurde Giersch insbesondere bei Gicht und Rheuma angewendet, was ihm den Namen «Gichtkraut» eintrug. Gicht ist eine schmerzhaft e Erkrankung, die durch Übersäuerung entsteht. Erhöhte Harnsäurebildung führt auf Dauer zu Ablagerungen in den Gelenken oder zu Nierensteinen. Zum Glück gibt es den Giersch! Verwenden Sie die ganz jungen Blätter roh im Salat, die etwas grösseren gedünstet wie Spinat, für Kräutersuppe oder Kräuterlimonade.
Giersch in der Wildkräuterküche
Der Giersch ist neben der Brennnessel eines unserer ältesten Wildgemüse. Eine besondere Delikatesse sind im zeitigen Frühjahr seine zarten Blattschösslinge als Salatgrundlage gemeinsam mit Möhren und Radieschen. Sie werden auch in der Kräuterbutter, im Kräuterquark, als Pesto oder in einer Quiche (z.B. gemischt mit Brennnesseln und Bärlauch) verarbeitet. Später im Jahr werden die Blätter etwas zäher und intensiver im Geschmack, sie können dann noch blanchiert oder in feine Streifen geschnitten als Einlage für Wildkräutersuppen verwendet werden. Die Blüten des Gierschs sind kräftige Aromageber und eignen sich hervorragend als Würze in Wildpflanzensalz, Kräuteröl und Kräuteressig. Die Samen des Gierschs kann man ins Brot hinein - backen oder über den Salat streuen.
Frischsaftkur mit Giersch
1 Handvoll frischer Gierschblätter mit dem Mixer pürieren und mit Wasser im Verhältnis 1:5 auffüllen. Über den Tag verteilt trinken, 2 bis 3 Wochen lang. Jeden Tag frisch zubereiten. Wie sagte schon Hippokrates (griech. Arzt, 400 v. Chr.): «Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein, eure Heilmittel eure Nahrungsmittel.»
Giersch in der Kräuterapotheke

Gierschtee
2 TL zerkleinerte frische, junge Blätter mit 1 Tasse kochendem Wasser aufgiessen. 5 bis 10 Minuten bedeckt ziehen lassen, abseihen. 3 x täglich 1 Tasse über 4 Wochen trinken. Der Tee eignet sich zum Abbau überschüssiger Harnsäure oder auch als Frühjahrskur.
Gierschauflagen
Bei Gicht oder rheumatischen Erkrankungen, nach Insektenstichen einige frische Gierschblätter mit einem Nudelholz anquetschen und auf die schmerzenden Stellen auflegen.
Giersch-Badezusatz
2 Handvoll Gierschblätter mit 2 Litern kochendem Wasser übergiessen, 10 Minuten ziehen lassen, abseihen und dem Badewasser zugeben.
Quellen und weiterführende Literatur:
- Couplan, F., Wildpflanzen in der Küche
- Fleischhauer, S.G., Guthmann, J., Spiegelberger, R., Enzyklopädie Essbare Wildpflanzen
- Lingg. A., Das Heilpflanzenjahr
- Ritter, C., Heimische Nahrungspflanzen als Heilmittel
- Storl, W.-D., Heilkräuter und Zauber pflanzen zwischen Haustür und Gartentor
Die Anwendung der angeführten Rezepturen erfolgt auf eigene Verantwortung und ersetzt keinen Arztbesuch. Eine Haftung der Verfasserin bzw. der Redaktion ist ausgeschlossen.
Kräuterkurse und Kräuterrundgänge mit Ernestine
Ernestine Astecker ist kant. appr. Naturheilpraktikerin und arbeitet in eigener Gesundheitspraxis in Fruthwilen, im Thurgau. In Kräuterkursen und auf Kräuterspaziergängen gibt sie gerne ihre Begeisterung, ihr Wissen und ihre Erfahrung über Heilpflanzen weiter.
Nähere Informationen zum Kursangebot unter www.eastecker.ch oder Telefon 043 322 86 70.
Weitere spannende Wildkräuter und Wildpflanzen in der Schweiz:
Schafgarbe - altes Wunderheilkraut
Die Gundelrebe - kraftvolles Blutreinigungsmittel
Der Löwenzahn - frische grüne Kraft in der Kräuterapotheke
NATURZYT Ausgabe März 2018, Text Ernestine Astecker, Fotos AdobeStock