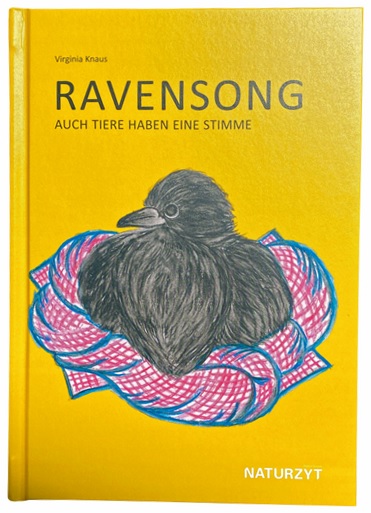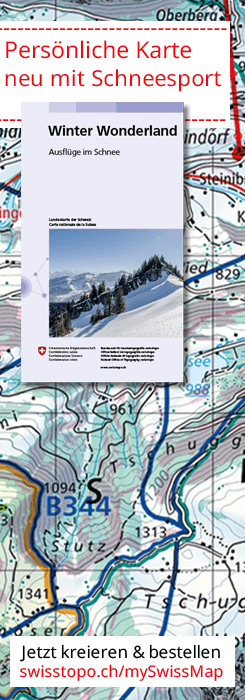Er ist die Wildform sämtlicher Hunde und lebt in einer sozialen Familiengemeinschaft. Seine Gestalt ist uns vertraut, gleicht er doch einem Schäferhund. Aber wenn er heult, geht es durch Mark und Bein.
Es ist lange her, dass NATURZYT über den Wolf berichtete in Zusammenarbeit mit der Organisation CHWolf. Seither habe ich mich immer wieder gefragt, wenn ich mit dem Fahrrad oder zu Fuss im Wald unterwegs war, wie würde ich reagieren, wenn mir ein Wolf begegnen würde? Und wie reagiert der Wolf? Wahrscheinlich hätte ich genau das gleiche ungute Gefühl, wie wenn mir ab und zu ein Schäferhund freilaufend im Wald begegnet. Natürlich sind die Halter jeweils nicht weit, aber ich weiss nie, wie der Hund reagiert. Rennt er auf mich zu oder bin ich völlig uninteressant? Auf jeden Fall, wenn einer auf mich zurennt, fällt mir das Herz zuerst in die Hose, denn ich weiss nicht, will er mich freudig begrüssen oder sieht er in mir eine Gefahr?

Und wie muss sich wohl ein Hirte oder die Einwohner im Calanda-Massiv fühlen, in welchem seit 150 Jahren wieder das erste Wolfsfrudel in der Schweiz lebt, wenn in einer kalten und nebligen Mainacht ein schauderhaftes Heulen ertönt? Da läuft es einem sicher eiskalt über den Rücken und eine Gänsehaut ist garantiert.
Weshalb tötet der Wolf mehrere Schafe?
Auch beschäftigte mich immer wieder die Frage, wenn berichtet wurde, ein Wolf habe wieder mehrere Schafe gerissen, weshalb er dies macht? Eines könnte ich verstehen, aber gleich drei oder vier!
Eine Wolfexpertin klärt mich auf. Für den Wolf ist es kein sinnloses Töten, sondern überlebensnotwendig. Man muss sich vorstellen, dass Wölfe manchmal tagelang ohne jegliche Beute auskommen müssen, denn sie sind spezialisiert auf grössere Huftiere wie Rehe, Hirsche, Elche und sogar Büffel. Sie fressen aber auch kleinere Säugetiere, Aas, Abfall und sogar Früchte. Und nun treffen sie mit knurrenden Magen auf eine Schafherde, welche ungeschützt und ohne Fluchtinstinkt gegenüber freilebenden Beutetieren weiden. Was für ein Schlaraffenland!

Dieses Mehrfachtöten, nennt man auch «Surplus Killing». Viele Wildtiere, nicht nur der Wolf, auch der Marder oder Fuchs im Hühnerstall, haben ein ganz normales «Beutegreifer-Programm». Die erste Phase löst einen Beutefangreflex aus, das heisst, die fliehende Beute wird gejagt. In der zweiten Phase wird erst gefressen. Wenn nun aber in einer Schafherde oder im Hühnerstall, die Tiere weiter fliehen, bleibt der Beutefangreflex aktiv, bis alle Tiere erlegt oder, falls sie können, ausser Sicht geflohen sind. Erst dann wird gefressen.
Das sieht im ersten Moment brutal aus, ist aber ein ganz normaler Überlebensinstinkt. Und würden wir Menschen, die Tierkadaver nicht entfernen, dann hätte nicht nur der Wolf, welcher täglich etwa 2–4 Kilogramm Fleisch verschlingt, über mehrere Tagen Nahrung, sondern auch viele andere Aasfresser wie Raben und Käfer würden davon profitieren. Somit wären die Schafe, welche übrigens dem Schafhalter von Bund und Kanton bezahlt werden, nicht umsonst gestorben.

Im Buch «Wolfodyssee» von Peter A. Dettling wird dieses Verhalten ebenfalls beschrieben, welches aber in freier Wildbahn selten vorkommt, weil dort die Beutetiere gelernt haben zu fliehen. Der Schweizer Naturfotograf hat mehrere Jahre verschiedene Wolfsrudel in Kanada, den USA und auch in der Survela im Calanda-Massiv beobachtet und das Verhalten studiert. In seinem Buch «Wolfsodyssee» hält er dies nicht nur eindrücklich fest, sondern weckt
damit auch Verständnis und Empathie für einen unserer ältesten Verbündeten.
Der Wolf war schon vor uns in der Schweiz
Die Wölfe waren früher in der ganzen Schweiz zu Hause, vor allem in Lebensräumen, welche Nahrung von Wildhuftieren aufwiesen und ihm genügend Deckung boten. Unsere Vorfahren kannten das nächtliche Heulen. Als der Mensch sesshaft wurde und auch begann, Nutzvieh zu halten, gab es keine Probleme zwischen Wolf und Mensch. Erst als die ersten Schusswaffen aufkamen und der Mensch intensiv begann, Reh, Rothirsch, Wildschein, Biber etc. zu jagen, und diese nahezu oder ganz ausgerottet hatte, musste der Wolf wohl oder übel auf andere Nahrungsquellen ausweichen. Dies führte zu starken Übergriffen auf die Nutztiere und besiegelte damit auch seine Ausrottung von Menschenhand. Der offiziell letzte einheimische Wolf wurde schliesslich 1871 bei Iragna im Tessin erlegt. Das Heulen in der Nacht verstummte.

Auch in unseren Nachbarländern Italien und Frankreich wurde er beinahe ausgerottet. Nur eine kleine Population von rund 100 Tieren konnte sich in den Abruzzen und einigen angrenzenden Gebirgszügen halten. Diese standen kurz vor der Ausrottung, als der Wolf 1972 endlich unter Schutz gestellt wurde. Die Wolfpopulationen in Italien erholten sich langsam und von diesen tauchten erstmals 1995 die ersten Wölfe wieder in der Schweiz auf.
Wölfe sind sehr soziale Tiere
Mittlerweile streifen neben dem Wolfsrudel im Calanda (GR) auch ein Rudel in Obersaxen (GR), Morobbia (TI), Surselva (GR), Beverin (GR), Jura (JU), Mittelwallis, Chablais (VS) und Entremont (VS) in den Wäldern umher. Und ab und zu heult es wieder in den Wäldern.

Ein Rudel besteht aus einem erwachsenen Wolfspaar, den diesjährigen Jungen und Jungwölfen aus den vorangegangenen Jahren. In der Regel besteht ein Rudel aus sechs bis zehn Tieren, je nach vorhandener Beuteart können es aber auch mehr sein. Rudel in der Grösse von sechs bis zehn Tieren können einen Hirsch erlegen, für Rehe reichen kleinere Rudel aus. Die zentrale Figur des Familienclans ist die Leitwölfin, welche sich mit dem Leitwolf um den Zusammenhalt des Rudels kümmert. Die Leittiere sind in der Regel die Elterntiere. Damit zeigen die Wölfe eine bekannte Struktur, wie wir sie bei uns Menschen kennen. Auch bei der Fortpflanzung zeigt sich die Qualität des Rudels. Denn nur mehrere zusammen können genügend Beute erlegen, um den riesigen Hunger der Jungen zu stillen, und das ganze Rudel hilft auch bei der Aufzucht. Die beiden Elterntiere des Rudels paaren sich zwischen Januar und März. Nach 61 bis 64 Tagen, in der grünen Jahreszeit, bringt die Leitwölfin zwischen vier bis sieben taube und blinde Welpen in der Wurfhöhle zur Welt. Nach etwa 3 Wochen öffnen diese die Augen und nach 4 Wochen halten sie sich vor der Höhle auf. Nach der Entwöhnung von der Mutter (nach 7–9 Wochen) hilft das ganze Rudel bei der Pflege und Fütterung mit. Die Jungwölfe haben eine lange Lehrzeit vor sich, um die Welpenaufzucht, die Jagd und das differenzierte Sozialverhalten richtig zu lernen. Nach zwei bis vier Jahren verlassen jüngere Wölfe das Rudel, um sich einem anderen Rudel anzuschliessen oder ein eigenes Revier, ihr eigenes Rudel, zu gründen.
Jedes Wolfsrudel oder jeder Familienverbund lebt in seinem eigenen Gebiet, welches zwischen 200 und 250 Quadratkilometer gross sein kann und durch das Angebot von Beutetieren bestimmt wird, denn die Ernährung des Rudels muss langfristig gesichert sein. Auch muss es den Tieren genügend Deckungs- und Rückzugsmöglichkeiten bieten, denn sie ziehen sich sofort zurück, sobald sie einen Menschen wittern. Und sie passen sich dem Verhalten ihrer Beutetiere an.

Der Wolf lernt laufend dazu und passt sich an. Wenn seine Beutetiere im Winter Richtung Siedlungen ziehen, folgt er diesen und kommt näher an bewohnte Gebiete. Lernt er im Rudel, wie einfach ungeschützte Schafherden zu erbeuten sind, werden auch diese Übergriffe verständlicherweise mehr. Werfen wir Abfälle weg oder füttern wir Wildtiere, wird er auch diese Plätze nutzen. So wird er auch mit der Zeit die Angst vor uns Menschen verlieren. Nicht der Wolf stellt das eigentliche Problem dar mit seiner Rückkehr, sondern wir Menschen mit unserem Verhalten und Vorurteilen. Ein Leben mit Grossraubtieren ist möglich, wenn wir lernen, uns korrekt zu verhalten, die Nutztiere wie in Italien zu schützen mit dem richtigen Herdenschutz etc.
Der Wolf wird in Märchen, in Geschichten als das «Böse» dargestellt, was er nicht ist, er ist nur ein wilder Hund, und die Gefahr, welche von ihm ausgeht, ist geringer als die eines sozialisierten und menschengewohnten Hundes. Und die Wahrscheinlichkeit, von einer Mutterkuh oder einem Stier beim Wandern verletzt zu werden, ist um ein Vielfaches höher.
Weitere Wildtiere die Sie kennen lernen sollten:
Wildkatzen - die wilde Katze ist zurück in der Schweiz
Steinmarder sind in der Schweiz weit verbreitet
Dachse in der Schweiz: Maskiert in die Nacht
NATURZYT Ausgabe September 2020, Text Michael Knaus, Fotos AdobeStock