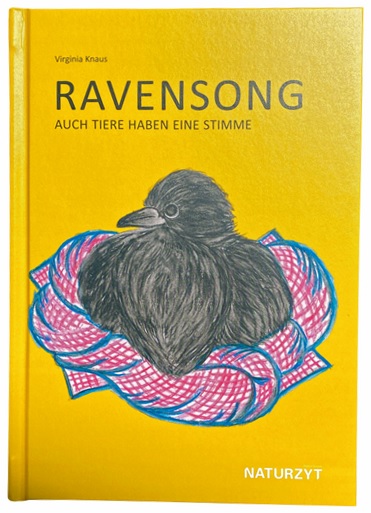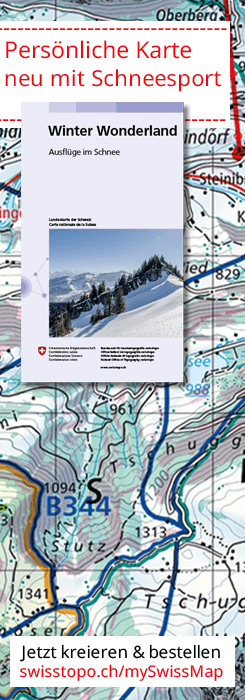Sie sind Frühlingsboten wie etwa die Schlüsselblümchen: Wenn die Weissstörche aus Afrika in unser Land zurückkehren, ist der Frühling nicht mehr weit. Auch nicht das Glück und die Babys.
Die schwarz-weissen Schwingen mausgebreitet, im langen roten Schnabel ein schreiendes Bündel – so bringt der Storch die Babys zu ihren Müttern. Jedenfalls wird dies seit dem 18. Jahrhundert erzählt, um Kinderohren nicht mit den wahren Umständen von Zeugung und Geburt belasten zu müssen. Dass ausgerechnet der Storch als Baby-Lieferant auserkoren wurde, ergibt durchaus Sinn: Da der Storch sich zur Nahrungssuche an Tümpeln oder flachen Gewässern aufhält, wird er in Verbindung zum Wasser gebracht. Wasser aber galt als Ursprung für den Beginn neuen Lebens, und schliesslich ist das Baby auch im Mutterleib von Wasser umgeben. Noch heute ist es in einigen Gegenden Brauch, nach der Geburt eines Kindes eine hölzerne Storchenfigur im Garten der frischgebackenen Eltern aufzustellen.

Für den Storch steht die Nahrungsbeschaffung an erster Stelle
Was aber treibt der Storch, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, Babybündel an ihren Bestimmungsort zu bringen? Wie für alle Tiere steht auch für den Storch die Nahrungsbeschaffung an erster Stelle. Mit seinen langen Beinen schreitet er gemächlich, ja beinahe zögerlich durch nasse Wiesen oder sumpfige Gebiete und hält nach Beute Ausschau. Hat er etwas Fressbares entdeckt, stösst er mit seinem Schnabel blitzschnell zu, packt die Beute wie mit einer Pinzette und verschluckt sie als Ganzes. Auf seinem Speisezettel stehen bevorzugt Regenwürmer, grössere Insekten, Frösche, Mäuse, Ratten, kleine Fische, Eidechsen oder auch Schlangen. Dieses Nahrungsangebot ist in unseren Gefilden im Winter deutlich reduziert, sodass die Weissstörche in den Süden fliegen müssen, um nicht zu verhungern.

Störche wissen von Geburt, wohin Sie im Herbst fliegen müssen
Anders als die Waldrappe kennen die jungen Störche den Weg nach Afrika. Das Wissen darum ist genetisch fest - gelegt, das heisst, Störche wissen bereits beim Schlüpfen, wann sie wohin fliegen müssen. Während Waldrappe die Zugroute von erfahrenen Artgenossen erst lernen müssen, machen sich junge Störche noch vor ihren Eltern auf den Weg in den Süden. Als Segelflieger sind die Weissstörche für die weite Strecke auf warme Aufwinde angewiesen. Da aber über dem Wasser keine Thermik entsteht, stellt das Mittelmeer ein Hindernis dar. Ein Hindernis, das allerdings nicht unüberwindlich ist, denn die Störche haben zwei Wege entdeckt, auf denen sie dem Mittelmeer ausweichen können: Der eine Weg führt über die Meerenge von Gibraltar nach Westafrika, der andere über den Bosporus, Israel und den Sinai ins Niltal und von dort weiter nach Ostafrika. Während die «Ostzieher» bis zu 10 000 Kilometer zurücklegen, um in ihr Winterquartier zu gelangen, entwickeln sich die «Westzieher» zunehmend zu Minimalisten. Immer häufiger schenken sie sich nämlich den Flug über die Meerenge von Gibraltar und verbringen stattdessen den Winter im südlichen Spanien. Nahrung finden sie dort in Reisfeldern, wo sie sich von Sumpfkrebsen ernähren und auf grossen offenen Mülldeponien, wo sie nach Essensresten und Küchenabfällen stochern. Laut EU-Richtlinien muss der organische Anteil von off en deponiertem Müll in den EU-Ländern sukzessive reduziert werden. Wie weit diese Richtlinien, die bis 2016 hätten umgesetzt sein sollen, tatsächlich umgesetzt werden und wie sich dies auf die überwinternden Störche auswirkt, ist noch völlig offen.

Gefährliche Reise der Störche
Ob «Ostzieher» oder «Westzieher», ob «Traditionalist» oder «Minimalist» – für alle Weissstörche ist die weite Reise in den Süden und wieder zurück ins Brutgebiet mit grossen Risiken verbunden. Denn unterwegs lauern tödliche Gefahren, zum Beispiel Stromleitungen, schiesswütige Jäger oder Pestizide. Nur jeder vierte Jungstorch schafft es im Frühling wieder zurück nach Europa. Doch auch hier herrscht nicht eitel Wonne: Trockengelegte Feuchtgebiete, begradigte Flüsse, eingedolte Bachläufe sowie eine intensive Landwirtschaft mit Monokulturen und chemischer Schädlingsbekämpfung entziehen dem Storch die Lebensgrundlage. Die Folgen sind für die Art fatal: Mit der Intensivierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert verschwand der Storch aus unserer Landschaft . 1950 brütete kein einziges Storchenpaar mehr in der Schweiz.

Störche sind ihrem Nest und Partner treu
Doch einer hat immer an den Storch geglaubt: Max Bloesch, Turnlehrer und Spitzenhandballer mit Olympiamedaille. Aufgeschreckt durch den alarmierenden Rückgang des Storchenbestandes, setzte sich Max Bloesch zum Ziel, die ausgestorbene Population wiederaufzubauen. Kurzerhand errichtete er im solothurnischen Altreu eine Storchenstation und importierte Störche aus dem Elsass, um sie zu züchten und anschliessend auszuwildern. Doch die Elsässer Störche wollten sich partout nicht paaren oder Eier legen. Also holte Bloesch mit Bewilligung des algerischen Gouverneurs Jungstörche aus der damaligen französischen Kolonie Algerien. Dies wurde ihm später zum Vorwurf gemacht – seine Störche seien ja gar nicht einheimisch, hätten die falschen Gene und deshalb kein natürliches Zugverhalten. Auch dass er die Störche fütterte, statt sie selbstständig nach Nahrung suchen zu lassen, und die Küken aufpäppelte, statt sie ihrem natürlichen Schicksal zu überlassen, wurde kritisiert. Doch in Bloeschs Storchenstation kamen immer mehr Jungvögel zur Welt. Trotzdem blieben Rückschläge nicht aus. Denn die gefütterten Tiere sahen keine Veranlassung, im Winter nach Süden zu ziehen, sondern blieben in Altreu. Doch dann begannen sie immer häufiger, im Herbst mit «echt wilden» Störchen wegzufliegen und im Frühling wieder zurückzukehren.

Die Stärchin Max
Einer von ihnen wurde mit einem Satellitensender ausgestattet und zu Ehren des «Storchenvaters» Max getauft . Erst später stellte sich heraus, dass Max ein Weibchen war. 13 Jahre lang versorgte die Störchin Max die Wissenschaft mit Daten über ihre Zugwege, die zurückgelegten Strecken, ihr Verhalten während des Zuges. Eindrückliche 60 000 Kilometer legte die Storchendame in ihrem Leben zurück, manchmal 300 Kilometer pro Tag, mit Rückenwind sogar 500 Kilometer. Überwinterte sie anfangs in Marokko, verbrachte sie in späteren Jahren die Winter in Spanien. 31 Jungstörche zog sie an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Partnern auf – Störche bleiben meist ihrem Horst treu; kehrt jedoch der Partner nicht rechtzeitig zurück, wird das Brutgeschäft mit einem anderen Partner in Angriff genommen. Im Dezember 2012 meldete der Sender keine Bewegungen mehr – die berühmteste Störchin der Schweiz war gestorben.
In Altreu sind die Storchengehege verschwunden, die Störche werden nicht mehr gefüttert, die Jungen nicht mehr mit Wärmelampen gewärmt. Die Vögel sind nicht mehr abhängig vom Menschen und können frei herumfliegen, nach Süden ziehen und sich ihren Horst bauen, wo immer es ihnen gefällt. Wie jener «Schwarzstorch», der eigentlich ein Weissstorch war, aber seinen Horst auf einem qualmenden Kamin gebaut hatte ... Arbeit gibt es aber immer noch genug: Statt Störche aufzupäppeln, muss nun vor allem ihr Lebensraum erhalten und aufgewertet werden. Die gegenwärtigen Bestrebungen zur Extensivierung der Landwirtschaft dürft en dem Weissstorch (und unzähligen weiteren Tier- und Pflanzenarten) entgegenkommen. Die Störche jedenfalls danken es: Um die 400 Paare brüten heute wieder in der Schweiz. Und sorgen so dafür, dass im Frühling buchstäblich das Glück in unser Land fliegt. «Adebar», wie der Storch in Fabeln genannt wird, setzt sich nämlich zusammen aus dem germanischen «auda» (= Glück) und «bera» (= tragen, gebären). Ein weiterer trifiger Grund, unseren Störchen Sorge zu tragen.

Dies und das zum Storch
Störche lassen sich am besten in ihren Brugtgebieten beobachten. Diese befinden sich dort, wo die Tiere eine Möglichkeit zum Nestbau haben und genügend Nahrung in der Nähe finden. Der Horst wird bevorzugt auf hohen, freistehenden Gebäuden, Masten oder Bäumen gebaut. Für die Nahrungssuche eignen sich Feuchtgebiete, Uferzonen von Flüssen und Seen sowie nasse Wiesen. In der Schweiz findet der Storch vor allem im Mittelland passende Bedingungen vor. Eine Karte zur Verbreitung des Weissstorches in der Schweiz findet sich auf www.vogelwarte.ch.
- Sogenannte «Storchenstützpunkte» gibt es in Avenches VD, Altreu SO, Grossaffoltern BE, Allschwil BL, Oberwil BL, Basel BS (Zoo und Tierpark Lange Erlen) Brittnau AG, Muri AG, Hünenberg ZG, Oetwil am See ZH, Steinmaur ZH, Hombrechtikon ZH, Zürich ZH (Zoo), Warth ZH, Kreuzlingen TG, Uznach SG, Kriessern SG und Mörschwil SG.
- Das Jahr 2016 war für die Störche in der Schweiz ein schlechtes Jahr: Die kühlen Temperaturen und der anhaltende Regen haben den Jung vögeln auf den exponierten Horsten arg zugesetzt. Unzählige Jungvögel fielen der Nässe und Kälte zum Opfer.
- Die Störchin Max sendet keine Daten mehr, doch andere Störche sind an ihre Stelle getreten. Sie tragen Namen wie Sämi, Segundo, Pepe, Carmen, Sünni, Elvis, Flocke oder Malou. Auf www.projekt-storchenzug.com lassen sich die Flugrouten der besenderten Störche verfolgen. Auffallend die hohe Sterbensrate unter den Jungvögeln: tot, tot, verschollen, tot, verunglückt, verunglückt, tot, tot heisst es da – ein weiterer Hinweis auf das gefährliche Leben der Weissstörche.
- Weitere Infos zum Weissstorch: www.storch-schweiz.ch
Mehr spannende Themen über Schweizer Wildtiere die interessant sind:
Der Steinbock - ein Überlebenskünstler
Murmeltiere - Überleben im Untergrund
Der Biber ist zurück in der Schweiz mit seinen Burgen
NATURZYT Ausgabe März 2017, Text Claudia Wartmann, Foto AdobeStock