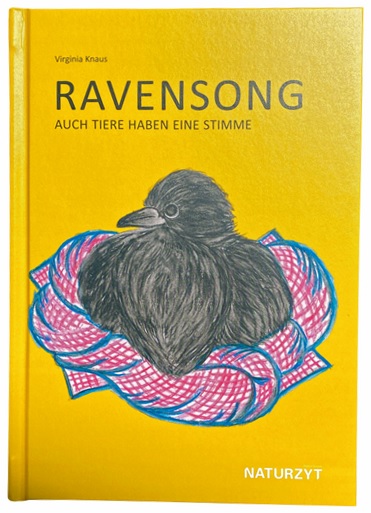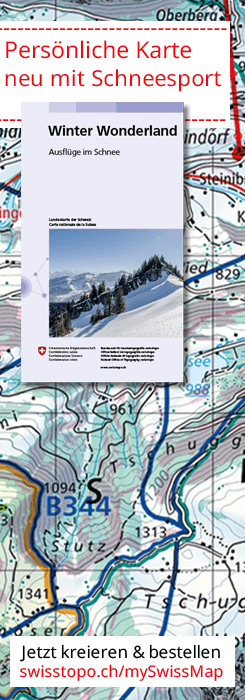Sind Mohn und Akelei erst einmal verblüht und die Gemüsebeete geräumt, neigt sich die Sommer-Saison dem Ende zu. Wer die reifen Samenstände von Blumen und Gemüse im Herbst erntet, kann sich jetzt schon auf reichlich Pflanzennachwuchs im kommenden Jahr freuen.
Blühende Sommerwiesen, Beete voller Ringelblumen, Salat oder Tomaten – die spannende Vielfalt der Pflanzen macht den Garten Jahr für Jahr zum Erlebnis. Der Ursprung dieses Lebens ist der Samen, der nach der Bestäubung gebildet wird. Wenn die Samenstände ausgereift und die Samen der Pflanzen ausgebildet sind, kann man diese ernten. Zwar lassen sich die meisten Sorten von Blumen und Gemüse auch in den Regalen des Fachhandels finden. Kultiviert man jedoch in den eigenen Beeten seltene Schätze, die besonders wuchsfreudig, schmackhaft oder schön sind, lohnt sich die Ernte und Lagerung des Saatguts durchaus, damit man sich auch im nächsten Jahr an seinen botanischen Lieblingen erfreuen kann.
Denn nicht immer kennt man etwa die Sorte des hübschen Mohns, welchen man von der Nachbarin geschenkt bekommen hat. Auch die Sorte des Tomaten-Setzlings, den man aus dem Urlaub in Italien mitgebracht hat, lässt sich hierzulande wohl kaum finden. Obwohl die Produktion von eigenem Saatgut aufwändig ist, kann es zudem eine schöne und sinnvolle Erfahrung sein, um den ganzen Lebenszyklus einer Pflanze zu erleben.


Mehr Erfolg mit Selbstbefruchtern
Im Prinzip kann man von allen Gartenpflanzen Samen gewinnen. Dies gilt auch für Blumen und Gemüse. Es gibt jedoch Einschränkungen: Sogenannte Fremdbefruchter sind schwieriger zu vermehren, da sie unter Umständen nicht sortenrein bleiben. Denn bei der Fremdbefruchtung kommt es zu einer Bestäubung zwischen Blüten verschiedener Pflanzen derselben Art. Wer also etwa blaue, weisse und rosafarbene Kornblumen im gleichen Garten kultiviert und im Herbst die Samen der Pflanzen erntet, wird im darauffolgenden Frühjahr nach der Aussaat kaum mehr dieselbe Farbenvielfalt im Beet vorfinden. Die genetische Vielfalt ist durch die geringe Anzahl an Pflanzen im Hausgarten meist zu klein. Zudem kommen Kreuzungen auch zwischen Gemüsesorten vor: So mischen sich Zucchetti und Patisson gerne bei der Bestäubung, die Samen der beiden Pflanzen sind also unbrauchbar.
Selbstbefruchter hingegen bestäuben sich selbst, der Pollen gelangt auf den Stempel der gleichen Blüte. Entsprechend benötigt man bei Selbstbefruchtern auch nur eine Pflanze, um Samen ernten zu können. Die meisten Gemüse zählen zu den Fremdbefruchtern – Hobby-Gärtnerinnen müssen also aufpassen, was sich im eigenen grünen Reich allenfalls kreuzen könnte. Von gängigen Selbstbefruchter-Arten wie Salat, Bohnen, Kefen, Erbsen, Tomaten, Peperoni und Auberginen lassen sich jedoch problemlos Samen ernten und im nächsten Jahr sortenrein wieder aussäen.

F1-Hybriden verändern sich
Eine zusätzliche Einschränkung bilden die sogenannten F1-Hybriden. Wird aus diesen besonderen Sorten Saatgut gewonnen, dann wachsen in der nächsten Generation Pflanzen mit veränderten Eigenschaften. So können sich etwa Tomaten in Busch- und Stangentomaten aufspalten. Von diesen Sorten sollte man deshalb keine Samen ernten. Es darf zwar durchaus gepröbelt werden, man muss jedoch darauf gefasst sein, dass sich aus der vollmundigen Hybrid-Zucchetti in der kommenden Freiluft Saison ein komischer, grüner Kürbis entwickelt.
Beachtet man diese Besonderheiten, ist die Ernte der Samen einfach. Grundsätzlich gilt es zu beachten, dass der Samen während der Ernte reif sein muss. Bei Blumen muss er also in den offenen Samenkapseln sichtbar sein. Einfach zu vermehrende Sorten sind hier die Akelei, der Fingerhut (Digitalis), das Schmuckkörbchen (Cosmea), Eisenkraut (Verbena), Sonnenblumen oder der Sonnenhut (Echinacea).

Kleine Samen aussortieren
Beim Gemüse gilt es, besonders kräftige Pflanzen auszuwählen und sie blühen zu lassen. Bei Fruchtgemüsearten ist für die Samenernte die Genussreife abzuwarten. Hier ist die Saatgutgewinnung etwas kniffliger, da sich die Samen im Fruchtfleisch befinden. Tomatensamen etwa sind von einer geleeartigen Masse umgeben, die keimhemmend wirkt. Deshalb bewahrt man die Samen im Fruchtsaft nach dem Herauslösen rund eine Woche in einem offenen Glas auf, bevor man sie mit Wasser spült und dann bei Zimmertemperatur trocknen lässt. Kürbis und Zucchetti sollte man für die Samengewinnung erst ernten, wenn die Schale so hart ist, dass man sie nicht mehr mit dem Fingernagel einritzen kann. Die Samen sind im Fruchtfleisch gut geschützt und reifen nach, weshalb man mit dem Aussamen noch einige Wochen, beim Kürbis zum Teil gar bis zum Februar warten kann.
Blumen- und Gemüsesamen müssen für die Lagerung vollständig trocken sein. Zur Überprüfung macht man zum Beispiel bei Bohnen den Biss-Test: Ist das Samenkorn zu weich, muss es noch länger auf Zeitungspapier zum Trocknen ausgelegt werden. Bevor das Saatgut endgültig für den Winter versorgt wird, muss es von allfälligen Pflanzenresten gesäubert und aussortiert werden. Bei zu klein geratenen Körnern lohnt sich eine Lagerung und spätere Aussaat nicht, da die Samen meist schon im folgenden Frühjahr nicht mehr gut keimen.

Aufgepasst vor Schädlingen
Gelagert wird das Saatgut möglichst kalt und trocken. Die Bedingungen sollten konstant sein, denn Schwankungen punkto Temperatur und Luftfeuchtigkeit schwächen die Samen. Unter günstigen Bedingungen lässt sich das Saatgut drei bis vier Jahre lagern. Schwarzwurzel und Schnittlauch bilden dabei eine Ausnahme: Ihre Samen sind besonders kurzlebig und über stehen nur gerade einen, allenfalls zwei Winter. In Schraubgläsern aufbewahrt, ist das Saatgut nicht nur vor Feuchtigkeit geschützt, sondern auch vor möglichen Schädlingen. Besonders gefürchtet ist der Bohnenkäfer: Man schleppt ihn oft unbemerkt bei der Samenernte als Ei oder Larve ein, worauf er die ganze Saat durch Lochfrass vernichtet. Auch Milben, Mehlmotten und andere Insekten können dem Saatgut schaden. Sie vermehren sich oft in Pflanzenrückständen wie Stielen, Kapseln oder Hülsen, die man bei einer unsachgemässen Verarbeitung mit den Samen lagert. Es ist deshalb wichtig, dass man bei der Ernte und Lagerung der Samen sauber und sorgfältig arbeitet.

Neue Gaumenfreuden dank alter Sorten
Sie heissen Munot, Lachsfarbener Kaktus, Goldstrahl, Baselbieter Röteli oder Oktoberli. Vielleicht erwachen mit den Namen der alten Blumen- und Gemüsesorten vergessen geglaubte Erinnerungen. Die schmackhaften und hübschen Sorten lassen sich aber auch ganz neu entdecken: Die Stiftung Pro Specie Rara mit Sitz in Basel widmet sich der Erhaltung und Förderung der genetischen Vielfalt in Fauna und Flora und hat Samen von rund 1500 Garten-, Acker- und Zierpflanzen im Sortiment. Kulturhistorisch ist diese Vielfalt ein wunderschönes Erbe.
Vollmundige Ernte
Traditionelle Gemüsearten wie Kardy, Knollenziest, Etagenzwiebeln und Wurzelpetersilie erfreuen den Gaumen mit ganz neuen Geschmackserlebnissen. Neuere Gemüsesorten werden heute vor allem unter dem Gesichtspunkt guter Transport- und Lagerfähigkeit angebaut. Der Geschmack ist dabei oft zweitrangig. Umso erfreulicher ist es, wenn Tomate, Gurke und Rüebli vollmundig schmecken. Ein weiterer Pluspunkt ist die aussergewöhnliche Optik: Blaue Kartoffeln, gelbe Radiesli oder gestreifte Tomaten beglücken auf dem Teller auch das Auge. Zudem ist der Anbau dieser traditionellen Sorten nicht aufwändiger als bei neuen Sorten. Auch bei den Blumensamen von Pro Specie Rara gibt es so manche Rarität zu entdecken. Etwa die Gurkenblättrige Sonnenblume, die Papierblume oder die Browallie – die meisten dieser Zierpflanzen wurden schon vor über hundert Jahren im Handel angeboten, sind aber aus unterschiedlichen Gründen in Vergessenheit geraten. Die Bandbreite ist riesig, und es tauchen glücklicherweise auch immer wieder Sorten auf, die als ausgestorben galten.
Augen- und Gaumenschmaus dank alter Sorten
Alte Gemüse- und Zierpflanzensorten drohen zu verschwinden – und damit auch ein Stück unseres kulturhistorischen Erbes. Wer seltene Sorten im Garten anbaut, hilft mit, die genetische Vielfalt zu erhalten. Doch auch aus anderen Gründen ist es lohnend, sich auf Traditionelles zu besinnen.
Rotonda Bianca Sfumata di rosa

Die Aubergine mit dem klangvollen Namen stammt aus Italien und bildet attraktive, runde Früchte mit weisser Schale und rosa-violetten Flecken. Das feste, aber zarte Fleisch ist von einer dünnen Haut umschlossen, hat einen milden Geschmack und weist nur wenig Samen auf. Augen- und Gaumenschmaus dank alter Sorten
Gelbe Gurke

Ihre Form ähnelt einer Nostrano-Gurke, sie ist aber gelb statt grün: Die Gelbe Gurke stammt von einer Familie aus Eschenbach, welche die Sorte über mehrere Generationen anbaute und kultivierte. Sie ist wuchsfreudig, kletternd und gut lagerfähig.
Emilie

Die rund 60 Zentimeter hohe Emilie bildet zarte Blütenköpfchen und eignet sich besonders gut als Schnitt- und Trockenblume. In der Schweiz war die Emilie um 1881 bei Samen Wyss im Katalog. Es gibt zwei Sorten: die hellorange «Irish Poet» und die rote «Scarlet Magic».
Filderkraut

Der spitze Kabis stammt zwar nicht aus der Schweiz, ist aber trotzdem einen Versuch wert. Er wird traditionell in der Filderebene bei Stuttgart angebaut, ist nun aber durch die Flughafenerweiterung bedroht. Das Filderkraut eignet sich besonders als Rohkost oder für Sauerkraut.
Goldmohn «Karminkönig»

Goldmohn ist – wie sein Name schon sagt – meist in gelben bis orangen Farbtönen zu finden. In England wurden verschiedene Selektionen getätigt, aus der die Sorte «Karminkönig» entstand. Der dunkelrot blühende Goldmohn kam 1911 erstmals in den Schweizer Handel.
Stiefmütterchen «Alpenglühn» und «Höhenfeuer»


Bis in die neunziger Jahre gehörten die Roggli-Stiefmütterchen mit ihren heimatverbundenen Namen zu den begehrtesten Sorten. Bei der Schliessung der Firma Rudolf Roggli übernahm Pro Specie Rara das Saatgut: Die Sorten «Alpenglühn» und «Höhenfeuer» sind wieder zu haben.
Hexenkraut

Das ein-bis zweijährige, kleeähnliche Kraut wird zur Schabziger-Herstellung verwendet. Im Tirol ist diese Sorte auch zum Würzen des Brotes gebraucht, weshalb es auch Brotklee genannt wird. Das Aroma entfaltet sich nach dem Trocknen und Mahlen besonders gut. Aussaat Ende August oder ab März.
Goldjohannisbeere «Black Missouri»

Diese Johannisbeer-Sorte stammt aus Nordamerika. Die Blüten sind entsprechend dem lateinischen Namen goldgelb und duften intensiv. Die Beeren sind metallisch schwarz. Bereits historisch war sie wichtig als Unterlage zur Veredlung von Johannisbeer- und Stachelbeerbäumchen.
Erba delle uova

Diese Aromapflanze wurde durch ein Projekt zur Inventarisierung von alten Nutzpflanzensorten in der Südschweiz entdeckt. Das Mutterkraut wurde häufig in Omeletten verwendet und macht die Eier besser verdaubar. Einmal im Garten vorhanden, sät sich die Pflanze selbst aus.
Kanarien-Kapuzinerkresse

Diese stark wüchsige Kletterpflanze – auch unter dem Namen Goldranke bekannt – weist zahlreiche leuchtend gelbe, geschlitzte Blüten auf. Diese Art wurde 1790 aus Peru eingeführt und wahrscheinlich zunächst auf den Kanaren angebaut. Sie wird nur rund 2 Meter breit, wächst aber kräftig in die Höhe.
Weitere Gartenthemen die Sie interessieren könnten:
Karden - stachelige Schönheiten für naturnahe Gärten
Pflanzen für optimale Staudenhecken
NATURZYT Ausgabe September 2024, Text Helen Weiss, Fotos ProSpecieRara, Pixelio.de, Envato Elements