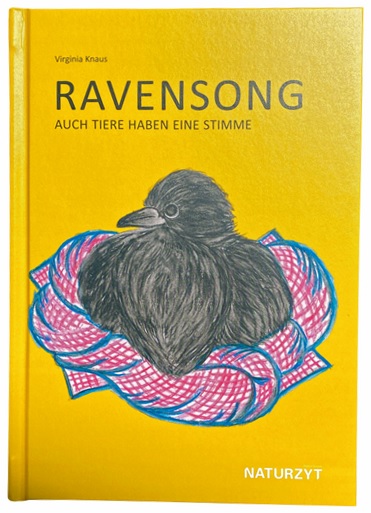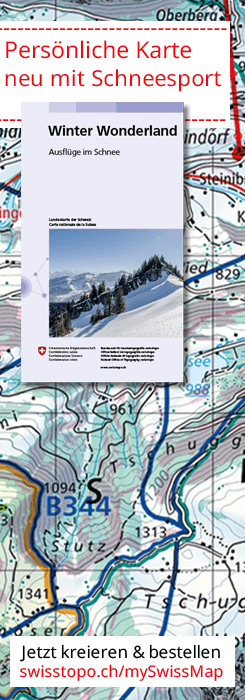Traditionell wird die Wiesenkönigin bei Erkältungskrankheiten, fiebrigen Infekten, schmerzenden Gelenken, Gicht und Muskelrheumatismus eingesetzt.
Die Wiesenkönigin im weissen Blütenkleid
Die Wiesenkönigin säumt mit ihrem weissen Blütenkleid wie eine Majestät Bachläufe und Flussufer. Sie liebt feuchte Standorte, und man findet sie auch auf Moorwiesen und in Auenwäldern, wo sie oft ganze Büsche bildet. Aus einem kriechenden Wurzelstock wachsen bis zu 2 Meter hohe kantige Stängel, die oft rötlich überlaufen und im oberen Teil verzweigt sind. Die gefiederten Blätter setzen sich aus einemdreiteilig gefiederten Endblatt und mehreren grösseren und kleineren paarig angeordneten Teilblättern zusammen. An der Unterseite sind sie heller gefärbt und leicht silbrig behaart. Von Juli bis September erscheinen an den verzweigten Stielen cremeweisse kleine Blüten, die einen herrlichen Duft nach Honig und Mandeln verströmen. Die im Herbst ausreifenden Früchte sind spiralig gedreht. Die Wiesenkönigin reiht sich ein in die Familie der Rosengewächse und wird von verschiedensten Insekten und Schmetterlingen bestäubt. Der botanische Name ist Filipendula ulmaria. In Mitteleuropa gibt es noch eine weitere Art der Gattung Filipendula, das ist die Knollige Spierstaude (Filipendula hexapetala oder F. vulgaris), die äusserst selten vorkommt und auf trockenen Böden wächst.
Für diese Pflanze gibt es viele Namen. Der weit verbreitete Name «Mädesüss» geht vermutlich darauf zurück, dass man die Pflanze früher zum Aromatisieren von Met (Honigwein) verwendete. Die duftende Pflanze nutzte man zum Ausreiben von Bienenstöcken, was auf den Namen «Immenkraut» hinweist. «Wiesengeissbart» wird sie genannt, weil sie dem Bart einer Geiss gleicht. Wegen der Form der Früchte wurde die Pflanze früher auch als «Spierstaude» bezeichnet, abgeleitet vom lateinischen Wort «spira», was Windung oder Spirale bedeutet. Der lateinische Gattungsname «Filipendula» bedeutet «an einem Faden hängend» und bezieht sich vermutlich auf die länglich hängenden Knöllchen der Wurzel. Der Zusatz «ulmaria» weist darauf hin, dass die Form der Blatt abschnitte den Blättern der Ulme ähnlich ist.
Die Wiesenköngin ist pflegeleicht im Garten
Die Wiesenkönigin ist im Garten leicht zu ziehen. Im Herbst streut man die Samen auf nasse Böden. Es bilden sich die grundständigen Blätter und im nächsten Jahr die Blüten. Man kann die Pflanze auch durch Wurzelteilung vermehren. Die duftenden cremeweissen Blüten und die schön gefiederten Blätter sind eine Zierde für jeden Garten. Die Wiesenkönigin ist mehrjährig und treibt im Frühjahr wieder aus.
Geerntet wird, wenn die Blüten sich öffnen
Die Pflanze wird geerntet, wenn sich die Blüten öffnen. Man schneidet sie mit einem Stück des Stängels ab und bündelt sie anschliessend zu lockeren Sträussen. Diese werden an einem luftigen und schattigen Ort zum Trocknen aufgehängt. Ein sauberes Tuch darunterlegen, um die abgefallenen Blüten aufzusammeln. Die Lagerung erfolgt dunkel und trocken am besten in Kartonboxen oder Glasgefässen mit Kunststoffdeckel. Metallgefässe sind zur Aufbewahrung ungeeignet. Im Spätherbst oder im zeitigen Frühjahr wird die Wurzel gegraben. Nach dem Waschen wird diese geschnitten und zum Trocknen aufgehängt.
Was sagen die Kräuterkundigen über die Wiesenkönigin?
Bei den Kelten gehörte die Wiesenkönigin zu den heiligen Kräutern, genauso wie das Eisenkraut und die Mistel. Angeblich wurden in früheren Zeiten die Böden der Gemächer damit bestreut, beim Darübergehen entfaltete sich ein erfrischender Geruch. Der Frankfurter Stadtarzt Adam Lonicerus beschrieb im 16. Jh. die Einnahme
der Wiesenkönigin bei Ruhr und zur Gallenreinigung. Äusserlich empfahl er die Pflanze bei Geschwüren anzuwenden.
Die Wiesenkönigin natürliches Schmerzmittel
Die wichtigsten Wirkstoffe der Wiesenkönigin sind Salicylsäureverbindungen, ätherisches Öl, Gerbstoffe, Flavonoide und Schleimstoffe. In der Leber wird Salicin in die wirksame Form, die Salicylsäure, umgewandelt. Salicylsäure wirkt fiebersenkend, entzündungshemmend, schmerzstillend und antirheumatisch. In der traditionellen Pflanzenheilkunde wird die Wiesenkönigin als bewährtes Heilmittel bei Erkältungskrankheiten, Grippe, fiebrigen Infekten, Gelenkschmerzen, Gicht und rheumatischen Beschwerden geschätzt. Die Pflanze wirkt ausserdem stark schweiss- und harntreibend, was die Ausscheidung von Giftstoffen aus dem Körper beschleunigt.
Im 19. Jh. wurde aus der Spierstaude erstmals Salicin isoliert, und später gelang es, den Wirkstoff Acetylsalicylsäure synthetisch herzustellen. Damals hiess das Mädesüss noch Spirea ulmaria. Daraus entstand der Name Aspirin. «A» steht für «Acetyl» und «spirin» wurde von «Spireasäure» abgeleitet.
Die Wiesenkönigin in der Homöopathie
Das homöopathische Mittel wird aus der frischen Wurzel hergestellt. Es wird vor allem bei Ischias und Gelenkrheumatismus und den damit verbundenen Schmerzzuständen, sowie bei Wasseransammlungen eingesetzt.

Die Wiesenkönigin in der traditionellen chinesischen Medizin
Die thermische Wirkung ist kühl, der Geschmack zusammenziehend und bitter. Die zugeordneten Organe sind Magen, Blase, Gedärme, Lunge und Niere. Wiesenkönigin kühlt Hitze, leitet Nässe und Feuchtigkeit aus und fördert die Harnausscheidung. Ausserdem wirkt es regulierend auf die Qi-Bewegung. Wiesenkönigin wird bei den gleichen Anwendungsgebieten verwendet wie in der europäischen Medizin.
Die Wiesenkönigin in der Wildkräuterküche
Die jungen Blätter können bis Juni zu Salaten und als Kochgemüse gegessen werden. Aus den Blüten kann ein Sirup hergestellt werden. Blüten und Blütenknospen eignen sich ausserdem zum Aromatisieren und Verfeinern von Obstsalat, Kuchen und verschiedenen Getränken. Auch gebackene Wiesenkönigin- Blüten (wie Holunderblüten) sind eine leckere Speise. Die Wurzeln finden im Frühjahr vor dem Austrieb der Pflanze Verwendung als Beigabe zu Gemüse und Suppen. Aufgrund des intensiven Geruches aller Pflanzenteile empfiehlt es sich, kleine Mengen zu verwenden.
Wiesenköniginsirup
1 kg Zucker, 1 L Wasser, 2 Bio-Zitronen in Scheiben geschnitten, 20 g Zitronensäure, 3 Handvoll Blüten. Die Zutaten in ein Glas- oder Keramikgefäss geben (kein Metallgefäss wegen der Säure), kühl stellen und mehrmals umrühren, damit der Zucker sich auflöst. Nach 48 Stunden abfiltrieren, kalt abfüllen und kühl aufbewahren. Haltbarkeit ½ bis 1 Jahr, je nach Lagerung und verwendeter Pflanze. Vorsichtsmassnahmen: Bei Salicylsäure-Unverträglichkeit darf die Wiesenkönigin nicht angewendet werden. Überdosierung ist zu vermeiden. Während Schwangerschaft und Stillzeit nicht verwenden.

Wiesenkönigin in der Kräuterapotheke
Die Blüten verströmen einen intensiven Duft nach Honig und Bittermandeln. Insbesondere beim Zerreiben der Blätter entsteht ein etwas strenger medizinischer Geruch.
Wiesenkönigin-Blütentee
1 bis 2 TL Kraut oder Blüten mit ¼ L kochendem Wasser übergiessen und 10 Minuten ziehen lassen, abfiltrieren. 2 x täglich 1 Tasse trinken. Der Tee wirkt schweiss- und harntreibend, fiebersenkend, schmerzlindernd, entsäuernd und «blutreinigend ». Er hilft bei Erkältungsbeschwerden, Gicht, rheumatischen Beschwerden und Kopfschmerzen.
Wiesenkönigintee zur äusserlichen Anwendung
Kompressen aus einem starken Teeaufguss unterstützen bei schmerzhaften Gelenkbeschwerden. Fussbäder und Packungen sind bei geschwollenen Beinen und Füssen wirkungsvoll.
Wiesenkönigin-Wurzeltee
Man lässt die Wurzelstücke mehrere Stunden in kaltem Wasser ziehen, kocht sie kurz auf und trinkt den Tee über den Tag verteilt in kleinen Schlucken. Dieser Tee hilft bei Wasseransammlungen und unterstützt Niere und Blase. Man kann die Wurzel auch kauen, und so gemacht, desinfiziert sie die Mundhöhle, neutralisiert Mundgeruch und hilft bei Zahnschmerzen.
Liebe Leserin, lieber Leser, wenn es mir gelungen ist, Sie mit diesem Kräuterbeitrag zu inspirieren und zu ermutigen, selber die eine oder andere Kräuterzubereitung herzustellen und auszuprobieren sowie Erfahrungen mit den Schätzen der Natur zu sammeln, freut mich das sehr. Ich wünsche Ihnen viel Freude und gutes Gelingen.
Ihre Ernestine
Quellen und weiterführende Literatur
- Brooke, E., Kräuter helfen heilen.
- Lingg, A., Das Heilpflanzenjahr.
- Loncar, S., Heilkräuter und Gewürze gegen Schmerzen.
- Mezger, J., Gesichtete homöopathische Arzneimittellehre.
- Storl, W.D., Die Seele der Heilpflanzen.
- Von Blarer Zalokar, U., von Blarer, P., Westliche Kräuter und Chinesische Medizin.
- Vonarburg, B., Natürlich gesund mit Heilpflanzen.
Kräuterkurse und Kräuterrundgänge mit Ernestine
Ernestine Astecker ist kant. appr. Naturheilpraktikerin und arbeitet in eigener Gesundheitspraxis in Fruthwilen, im Thurgau. In Kräuterkursen und auf Kräuterspaziergängen gibt sie gerne ihre Begeisterung, ihr Wissen und ihre Erfahrung über Heilpflanzen weiter. Nähere Informationen zum Kursangebot unter www.eastecker.ch oder Telefon 043 322 86 70.
Weitere Wildpflanzen und Kräuter die spannend sind kennen zu lernen:
Ruprechtskraut - altes Heil- und Hausmittel der Natur
Rosmarin - entfacht Lebensfeuer
Holunder - heilkräftiger Schutzbaum
NATURZYT Ausgabe September 2020, Text/Fotos Ernestine Astecker